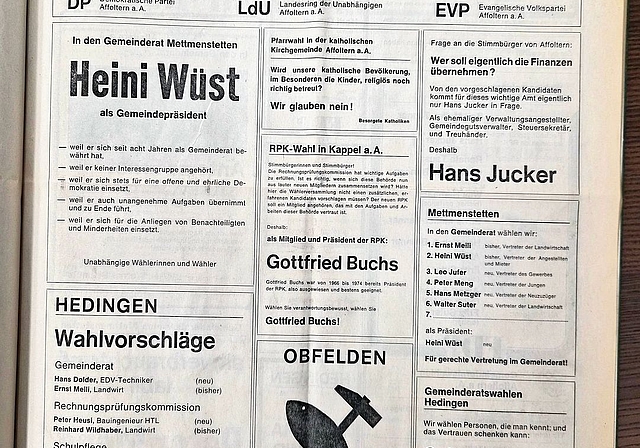«Russland hat ein fast unbegrenztes Reservoir an Soldaten»
Die Sicht eines langjährigen Russland-Korrespondenten auf die Vorgeschichte des Ukrainekriegs
Insgesamt 13 Jahre lang war Peter Gysling Russland-Korrespondent von SRF. Er erlebte die Ära Gorbatschow, das Ende des Ostblocks, die Zeit von Boris Jelzin und den Aufstieg Putins. An der Volkshochschule Knonauer Amt schilderte er in sehr persönlichen Ausführungen seine Sicht des Ukrainekriegs.
Gorbatschow war der letzte Staatschef der Sowjetunion. Seine Reformpolitik mit den Schlagwörtern Glasnost und Perestroika wollte die kommunistische Planwirtschaft durch marktwirtschaftliche Strukturen ersetzen. Der Westen war erfreut, aber innerhalb der Kommunistischen Partei der Sowjetunion regte sich Widerstand. Ein Putschversuch in Moskau während Gorbatschows Ferien wurde abgewehrt. Einer der wichtigsten Putschgegner war Boris Jelzin. Dieser wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zum ersten russischen Präsidenten gewählt. 1999 übergab er sein Amt Wladimir Putin, den er stark gefördert habe, wie Peter Gysling ausführte.
Das kommunistische System hatte auch sein Gutes
«Nicht alle kommunistischen Werte waren schlecht», fuhr Gysling fort. Alle Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion hätten ein Recht auf Ausbildung, Gesundheitsversorgung, ein Dach über dem Kopf gehabt, garantiert vom Staat. Mit Privatisierungen, der Einführung der Religionsfreiheit, der Infragestellung sozialistischer Werte habe Gorbatschow und in seiner Nachfolge Jelzin Verunsicherung ausgelöst. Vor allem die Privatisierung des Staatsvermögens habe zu Gewinnern und Verlierern geführt: «Einige wurden sehr reich, nicht illegal, aber illegitim.»
Auf der anderen Seite hätten viele russische Familien überlebt, weil die ganze Gesellschaft noch stark agrarisch ausgerichtet sei. Im Garten der Datscha oder vielleicht gar auf dem Balkon in Moskau habe man Gemüse und Kartoffeln angebaut, um sich zu ernähren.
Nach der Verunsicherung unter Jelzin habe Putin in seiner ersten Präsidentschaft von 1999 bis 2007 vor allem Strukturen und Ordnung geschaffen. Mithilfe von Geld aus dem Ölgeschäft sei ihm dies gut gelungen. Verfassungskonform sei er nach zwei Amtsdauern zurückgetreten, worauf Dimitri Medwedew die Nachfolge angetreten habe. 2012 habe Putin dann aber bekanntgegeben, er übernehme das Staatspräsidium erneut. Die Opposition sei zu diesem Zeitpunkt bereits so weitgehend ausgeschaltet gewesen, dass dies niemand hätte verhindern können. Die Demonstrationen gegen ihn habe er brutal unterdrückt.
«Putin ist im Kern noch immer der Geheimdienstmann, der von einem russischen Imperium im Umfang der Sowjetunion träumt», fuhr Gysling fort. Er sichere sich persönlich äusserst wirkungsvoll ab. Im ganzen Land habe er Paläste gebaut, so dass man nie wisse, wo er sich gerade aufhalte, ein Attentat wäre daher kaum erfolgreich.
Im Gegensatz zum agrarischen Russland sei die Ukraine, die vor dem Krieg 45 Mio Einwohnerinnen und Einwohner gezählt habe, recht stark industrialisiert, etwa in den Sparten Rüstung, Chemie und Nahrungsmittel. Auch in der Ukraine herrsche Korruption, «aber im Gegensatz zu Russland gibt es immer wieder demokratische Wahlen, was sich darin zeigt, dass es immer wieder Regierungswechsel gegeben hat. Es existiert eine Zivilgesellschaft, die sich Gehör verschaffen kann.»
Der Krieg begann im Schatten der Olympischen Winterspiele
Der Ukrainekrieg habe eigentlich während der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 begonnen, während der berühmten Maidan-Demonstrationen in Kiew. Im Schatten der Olympischen Spiele seien zunehmend grün gekleidete Soldaten ohne Kennzeichen auf der Krim gesichtet worden. Gysling ist damals selbst zur Krim geflogen, wo er grosse russische Transportmaschinen auf dem Flughafen und unzählige dieser «grünen Männer» gesehen habe. Es folgte die Annexion der Krim mit einem Scheinreferendum: auf dem Abstimmungszettel habe nur Ja angekreuzt werden können, das Nein habe gefehlt. Gefolgt sei der russische Vorstoss in den Donbass mit dem Aufbau pro-russischer Milizen.
Als Russland im Februar 2022 die Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen habe, habe die ganze Welt eine Machtdemonstration zur Verhinderung eines weiteren Ausgreifens der Nato vermutet. Kaum jemandem sei aufgefallen, dass die mitgeführten Kremationswagen für gefallene Soldaten als untrügliches Zeichen für den baldigen Angriff hätten gewertet werden können.
Gysling ist pessimistisch und rechnet nicht mit einem baldigen Kriegsende. Hinzu komme die Gefahr, dass Trump wieder Präsident der USA werden könnte, der angekündigt habe, er würde den Krieg innerhalb eines Tages im Gespräch mit Putin beenden. Eine weitere Gefahr sei, dass der Ukraine immer weniger Soldaten zur Verfügung stünden angesichts der vielen Toten, während Russland über ein schier unendliches menschliches Reservoir verfüge. Doch selbst im Fall eines Friedensschlusses werde der Konflikt noch lange Zeit nachwirken, etwa bei der Rückführung der Flüchtlinge, deren Hab und Gut unter Umständen längst jemand anders zugewiesen worden sei.