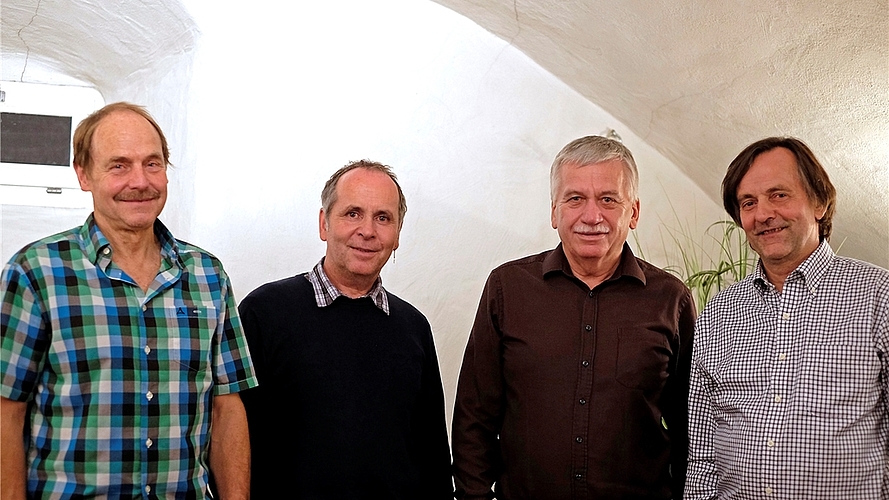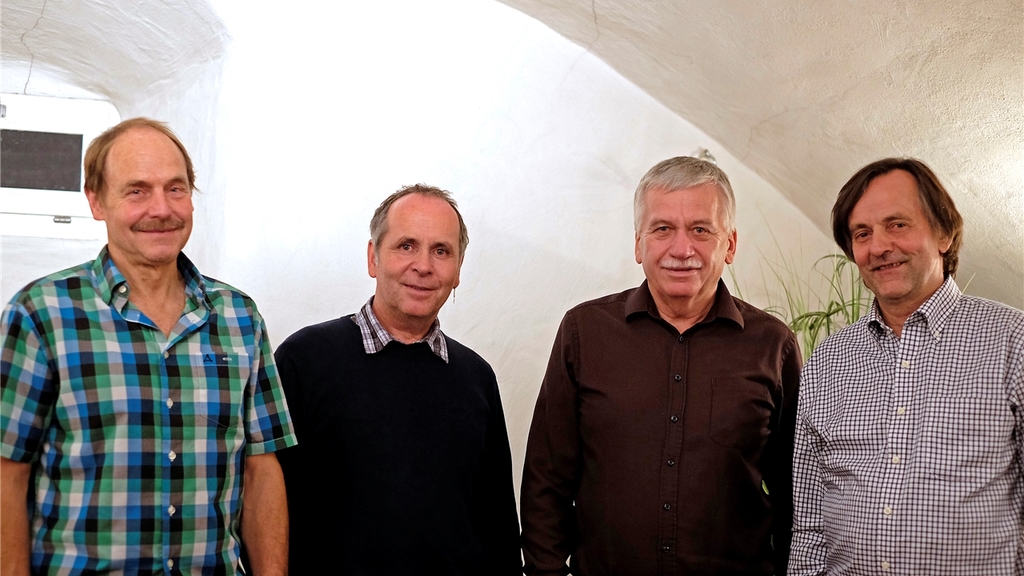Hat Handwerk noch goldenen Boden?
Die Kunsthandwerker Moritz Häberling, Christoph Roth und Oskar Studer zu Gast im «LaMarotte»
Das Bild, das die drei Kunsthandwerker Moritz Häberling, Christoph alias Stöff Roth und Oskar Studer am Samstagabend vom Berufsstand des Handwerkers gezeichnet haben, ist ein zwiespältiges. Echtes Handwerk ist zwar noch immer gefragt und wird heute, weil es eben nur noch selten zu sehen ist, in einzelnen Branchen sogar als Kunsthandwerk bezeichnet. Aus Rentabilitätsgründen und schlicht auch wegen des fehlenden Wissens beziehungsweise fehlender Sensibilität und Fantasie der Planer ist es jedoch deutlich weniger gefragt wie noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Quintessenz der unterhaltsamen fünf Stunden im Affoltemer Kellertheater LaMarotte, moderiert von «Anzeiger»-Chefredaktor Werner Schneiter.
Bezogen auf die drei früheren Schulkollegen, die alle die Oberstufe in Hausen besucht hatten, kann man zwar klar sagen, dass Handwerk noch immer goldenen Boden hat. Bis es jedoch so weit ist, ist Talent, Können, Kreativität und vor allem Eigeninitiative gefragt. Gemein ist dem Trio zeichnerisches Talent, ein überragendes räumliches Vorstellungsvermögen, überdurchschnittliches Wissen in der Materialkunde sowie ein ausgeprägtes Interesse an Kunsthistorik, alten Produktionsmethoden und Bauweisen, die in der Masse zumeist der Industrialisierung und der Globalisierung zum Opfer gefallen sind. Das Trio hat sich mit seiner Spezialisierung ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, dass sich in Kreisen des Denkmalschutzes und zugewandten Planern und Bauherren herumgesprochen hat.
Zuerst Hochbauzeichner, dann Hafner
Stöff Roth hat zuerst Hochbauzeichner gelernt. Bei Bauführungen haben ihn in alten Gebäuden immer wieder die kunstvollen Holz- und Kachelöfen fasziniert, die aber allzu oft abgerissen und entsorgt wurden. Deshalb hat der Rifferswiler auch noch Hafner gelernt; ein Beruf, der heute Ofenbauer heisst, weil den Begriff Hafner offenbar niemand mehr verstehe, wie Roth ausführte.
Hafner komme vom Grobkeramiker, der einst präzise Gefässe modelliert hat. Mit der Zeit habe die Nachfrage jedoch nachgelassen. Die bequemeren Elektro-, Gas- und Ölheizungen haben die Holzfeuerungen zusehends verdrängt. Damit hat sich auch das Berufsbild gewandelt. Nur noch selten gebe es Ofenbauer, die wie er Kacheln selber anfertigten, sagte Roth. Die dazu nötigen Formen aus Holz baue ihm jeweils Oski Studer. Die ursprüngliche Technik des Kachel- und Ofenbaus habe sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Noch immer sei in erster Linie Handarbeit mit «alten» Materialien angesagt. Neue Baustoffe bzw. Klebstoffe hätten sich nicht bewährt. «Kacheln halten bis 200 Jahre, der Ofen selber bis 100 Jahre», wobei er immer wieder Exemplare antreffe, die viel älter seien. «Es ist vor allem die Erfahrung, die ich bei Restaurationen und Abbrüchen sammle, die Gold wert ist», sagte Roth. Das sei es auch, was er an seinem Beruf so liebe: die Vielseitigkeit und Abwechslung im Wechselspiel von Bauen, Restaurieren und Abbrechen. Wegwerfen sei nicht sein Ding. Seit geraumer Zeit sammelt er alte Öfen. In besonderer Erinnerung ist ihm nach einer Feuersbrunst die Rekonstruktion der Kachelöfen im Zürcher Zunfthaus der Zimmerleute geblieben. «Bei der Begehung nach dem Brand hat sich anhand von Fragmenten herausgestellt, wie der Kachelofen beschaffen war. Der Zufall wollte es, dass im Landesmuseum ein baugleiches Exemplar zerlegt eingelagert war. Es wurde als Leihgabe ins Zunfthaus gegeben. So wurde das Zunfthaus zur Aussenstation des Landesmuseums», erzählte Roth, der den Ofen aufbauen durfte. Roth bedauert, dass man in derBranche über Lehrlingsmangel klagt. Aber es wundert ihn nicht. Schweizweit würden nur noch 15 bis 20 Ofenbauer ausgebildet. Viele arbeiteten jedoch nicht lange auf dem Lehrberuf, da meist nur noch vorgefertigte Bausätze montiert würden. Umso mehr freut Stöff Roth, dass er sein grosses Fachwissen im Betrieb an seinen Sohn Ueli weitergeben kann, der Zimmermann gelernt hat.
Zuerst Metallbauschlosser, dann Kunstschmied
Auch bei Moritz Häberling haben drei seiner sechs Kinder ähnliche Berufswege wie der Vater eingeschlagen. Wobei: Der Beruf Kunstschmied, den der Uerzliker ausübt, kann man so eigentlich gar nicht lernen. «Ich habe eine Metallbauschlosserlehre absolviert. Da man Schmied und Kunstschmied nicht lernen kann, bezeichne ich mich als Metaller», bekennt Häberling. Seinen Werdegang haben seine Interessen und Talente vorgegeben: Ein gutes Auge, Interesse an Kunstgeschichte und Architektur sowie ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Häberling interessiert sich zudem für die Entwicklungsgeschichte der industriellen Fertigung und historischen Stahlbau. Um zu restaurieren, müssen die Stahlkompositionen zuerst in ihre Einzelteile zerlegt werden. Über den Rost zu streichen, werde zwar immer wieder praktiziert, sei aber nur von kurzer Dauer. Nieten sei angesagt, Schweissen nur im Holzkohlefeuer. Dazu braucht es allerdings siliziumfreien Stahl, erklärte Häberling.
Wie Roth beobachtet auch er die Entwicklung der Berufslehre mit gemischten Gefühlen: «Wir mussten bei der Abschlussprüfung noch schmieden. Heute ist das nicht mehr gefragt.» Er habe schon in der Lehre gerne geschmiedet. Aber schon damals habe ihm der Arbeiter gesagt, das sei vorbei. Stirbt der Beruf aus? Von seinen Lehrlingen habe nur einer ein eigenes Geschäft eröffnet. Die Projekte, die Häberling bereits ausführen durfte, zeigen jedoch, dass es durchaus einen Markt für hochwertige Schmiedekunst gibt. Gearbeitet hat der Uerzliker mit seinem Team schon im Bundeshaus, im Opernhaus und an zahlreichen weiteren bekannten Schweizer Kirchen und Gebäuden moderner und klassischer Prägung. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die Renovation der Villa Patumbah in Zürich. Dabei galt es nicht nur den riesigen Zaun inklusive gusseiserner Säulen wiederherzustellen – Häberling eignete sich dazu das Wissen eines Eisengiessers an. Auch an der stählernen Fassade eines Seitentrakts hatte der Zahn der Zeit schon arg genagt. Daneben betätigen sich Häberling und seine Frau Margrit gerne auch kulturell, machen in Volkstheatern mit oder organisieren auf ihrem Grundstück oder in der Kiesgrube Uerzlikon Anlässe wie den Feuerzauber, der schweizweit Beachtung fand.
Zuerst Schreiner, dann Holzbildhauer
Oskar Studer wiederum legte den Grundstein zu seiner beruflichen Laufbahn mit einer Lehre in der Schreinerei Cochard in Mettmenstetten, die auf Stilmöbel spezialisiert war. Die Schnitzereien wurden jedoch immer auswärts gegeben, was Studer bedauerte. Er beschloss deshalb, an der Bildhauerschule in Brienz (wo er bis heute in der Aufsichtskommission sitzt und als Experte Lehrabschlussprüfungen abnimmt) eine dreijährige Zusatzlehre anzuhängen. Schon damals war die Bildhauerschule auf Stil- und kunstgeschichtliche Schnitzereien spezialisiert. «Noch heute können nur sechs bis acht Kandidaten die Lehre nacheiner Aufnahmeprüfung antreten», erklärt Studer. Mit seinem Kunsthandwerk hat der Hausemer, der sein Atelier in Türlen neben dem Restaurant Erpel betreibt, internationale Anerkennung erlangt. Seine Spezialität sind Kirchenorgeln, besser gesagt: die kunstvollen Schleiergitter, die die Mechanik der riesigen Instrumente verbergen.
Auf die Idee gekommen ist er durch den früheren Uerzliker Orgelbauer Peter Ebell. Das Talent, die Kreativität, Präzision und Hingabe, mit der Studer zuwerke ging, sprach sich unter den Denkmalpflegern rasch herum. Bald schnitzte er Akantusblätter fürs Opernhaus, Engel für Kirchen, Ornamente fürs Geländer am Limmatquai, die Häberling anschliessend als Vorlage für die stählernen Abbilder dienten, aber auch Skulpturen auf Bestellung zum Beispiel für Preisverleihungen (u. a. für den Säuliämtler Sports Award, Red Bull Velodux). Zu den Paradestücken zählen die Schleiergitter aus Mahagoni für eine Orgel für Taipeh, ein flügelförmiger Tisch für den spanischen Architekten, Bauingenieur und Künstler Santiago Calatrava sowie Requisiten (eine Geige mit geschnitztem Löwenkopf) für die Verfilmung des Kinderbuches «Shana, das Wolfsmädchen» von Federica de Cesco. «Nachwuchsprobleme haben wir in unserem Beruf nicht. Es ergibt keinen Sinn, jedes Jahr 30 Personen auszubilden, wenn danach nur sieben auf dem Beruf arbeiten können», schloss Studer dem Abend versöhnlich.