«Tiend üch s Läbe nid verpfusche und statt bade lieber dusche!»
Konrad von Sellenbüren kam um 1120 aus dem Reppischtal nach Engelberg, um das Kloster zu gründen. Dies ist historisch nicht umstritten. Wie und weshalb dies geschah, ist Gegenstand der Gründungssage. Der Engelberger Pater Thomas Blättler erzählte diese und weitere Sagen in der Bibliothek Stallikon.
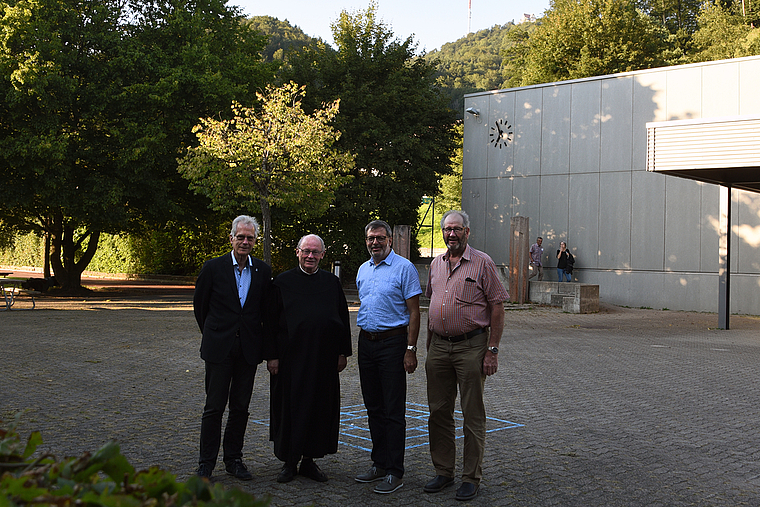
Das Schulhaus Loomatt befindet sich unterhalb des Ofengüpfs: des Burghügels, auf dem die Burg Konrads von Sellenbüren gestanden hatte – ein passender Ort für den von eben diesem Konrad vor 900 Jahren geschaffenen Anlass zum Besuch der Engelberger in Stallikon. Die Burg selbst ist nicht sagenhaft, sondern bestand real während etwa 50 Jahren. Sie wurde wohl kurz nach der Gründung des Klosters Engelberg geräumt und niedergebrannt, damit sie nicht von Feinden genutzt werden konnte. Sie bestand somit etwa 1070–1120 und kann aufgrund der Ergebnisse der Ausgrabung von 1953 einigermassen rekonstruiert werden.
Archäologische Zeugnisse der Burg befinden sich im Landesmuseum. Auf dem Ofengüpf selbst sind keine Überbleibsel mehr vorhanden. Eindrücklich ist die Topografie, die sich beim Besteigen des Hügels erkunden lässt.
Sagen erklären Realität
Gemäss der Gründungslegende, die Pater Thomas Blättler erzählte, erhielt Freiherr Konrad von Sellenbüren den göttlichen Auftrag, ein Kloster zu gründen. Konrad ritt zu seinem Besitz am Vierwaldstättersee und liess Steine zu einer Mauer aufschichten. Am nächsten Morgen lagen die Steine zerstreut am Boden, die Mauer war eingestürzt. Dasselbe geschah am Tag darauf. Nun schaute der Freiherr hilfesuchend zum Himmel, wo ihm Engel erschienen, die ihm bedeuteten, dies sei nicht der von Gott bestimmte Ort für den Klosterbau. Sie forderten ihn auf, sich von einem Zugochsen leiten zu lassen. Dieser zog seine Fuhr ungebremst den Berg hoch, bis er auf einer Wiese, die noch heute Ochsenmatt heisst, tot zusammenbrach. Nun erschienen singende Engel, die dem Kloster, das Konrad hier errichten liess, den Namen geben.
Ein Kreuz stoppt den Teufel
Pater Thomas erzählte weitere Sagen, die durchgehend das Motiv enthalten, dass der Teufel – allenfalls vertreten durch eine Hexe – den Bau eines Gotteshauses verhindern oder fromme Menschen verführen wollte. Oft entstanden Sagen zu auffälligen Felsbrocken, deren Lage man sich nicht erklären konnte, so etwa zum «Teufelsstein» im Engelberger Horbistal auf dem Weg zur Alp Rugghubel: «Grosse Steine fordern oft die Fantasie heraus und werden deshalb von Sagen umwoben.»
Der Teufel wollte im Horbis eine oft besuchte Kapelle zerstören. Er ergriff einen Felsbrocken, um diesen auf den heiligen Ort zu werfen. Doch eine fromme Bauersfrau, die betend auf den Teufel zukam, erfasste dessen Absicht und malte hinter dem Rücken des Teufels ein Kreuz auf den Stein. Nun vermochte der Teufel diesen nicht mehr zu tragen und verschwand wütend mit einem grausigen Schrei und einer stinkenden Stichflamme. Das vom 2019 verstorbenen Künstler José de Nève auf den Stein gemalte Teufelsbild wurde kürzlich wieder aufgefrischt.
Sagen in Varianten
Schiller liess in der ersten Szene seines Wilhelm-Tell-Dramas den Obwaldner Konrad Baumgarten vor den Reitern des Landvogts fliehen, den er im Bad erschlagen hatte, um die Vergewaltigung seiner Ehefrau zu verhindern. Die Geschichte des Landvogts, der die fromme Ehefrau genötigt hatte, warmes Wasser zuzubereiten, um ein Bad mit ihm zu nehmen, wird bis zur Gegenwart neu erzählt.
Pater Thomas las zuerst Schillers Vorlage vor, anschliessend eine Sage, die nahtlos von der Ermordung des fiktiven Landvogts zur Rütlischwur-Sage führte. Und schliesslich eine humorvolle Version in Gedichtform, die endet: «Z zweite bade lohnt sich nid, tiend üch s Läbe nid verpfusche und statt bade lieber dusche!»
Obwaldner Dialekte
Der Abend fand im Rahmen der Feiern zum 900+1-Jahre-Jubiläum statt, wie die Co-Leiterin der Bibliothek, Ariane Buffat, in ihrer Begrüssung ausführte. Gemeindepräsident Werner Michel, gebürtiger Kernser, wies darauf hin, dass Obwalden aus sieben Gemeinden mit fast ebenso vielen Dialekten bestehe. Er knüpfte bei der Verschiebung der Jubiläumsfeiern von 2020 auf 2021 und, in Stallikon, auf 2022 an: «Wir haben auf dieses Jubiläum 900 Jahre lang gewartet, jetzt kommt es auf eines oder zwei auch nicht mehr an.»



