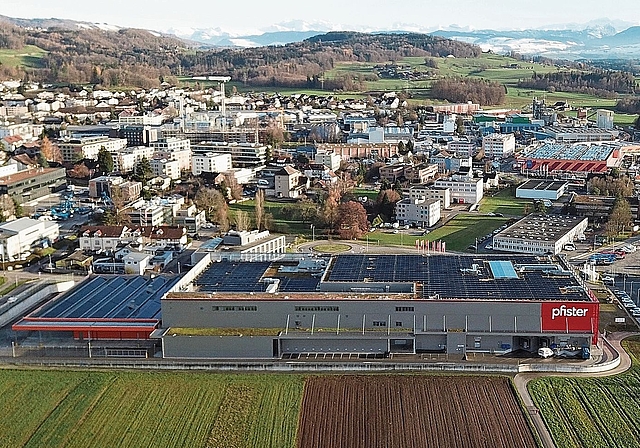Wie viele Sekundarschüler pro Klasse sind ideal?
Auf diese Frage haben die Schulgemeinden im Knonauer Amt unterschiedliche Antworten

2022/23 besuchten im Kanton Zürich 33821 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe I an einer öffentlichen Schule. Aufgeteilt in rund 1700 Klassen. Das ergibt eine durchschnittliche Klassengrösse von 19 bis 20 Jugendlichen. In den Schulgemeinden des Knonauer Amts schwanken die A-Klassengrössen von 18 (Bonstetten/Wettswil) bis zu 31 (Affoltern) Personen. Die Unterschiede sind also beträchtlich.
Urs Bregenzer, Schulpflege-Präsident der Oberstufe Affoltern/Aeugst äussert, seine Idealvorstellung läge bei 15 bis 18 Jugendlichen pro Klasse. Zurzeit sei dies aber Wunschdenken. In diesem Jahr werden im ersten Jahrgang zwei A-Klassen mit je 27 und drei kombinierte B/C-Klassen mit 11 bis 13 Schülerinnen und Schülern geführt.
Die 2. Sekundarstufe zählt gar zwei reine A-Klassen mit je 31 Jugendlichen. Die grossen A-Klassen bestehen jeweils aus zwei Halbklassen. Das bedeutet, dass gewisse Lektionen, wo mehr Interaktion gefordert ist, wie zum Beispiel bei den Sprachfächern, in der Halbklasse unterrichtet werden. Andere wiederum, wo eher Frontalunterricht praktikabel ist, wie in der Mathematik, werden im Plenum vermittelt. Bestenfalls arbeiten die Kinder in der ganzen Klasse in Ruhe an einer Aufgabe. Dies zur Theorie!
In der Praxis ist es für die Lehrpersonen mitunter schwierig, 30 Jugendliche zu zähmen und ihnen konzentriertes Lernen zu ermöglichen. Zum Leidwesen von einigen Schülerinnen und Schülern, denn die Motivation, in der Schule lernen zu wollen, zeigt sich heute in der Schülerschaft so unterschiedlich wie eh und je.
Darum wünscht sich auch Manfred Knecht, Schulleiter der Sek Mettmenstetten, kleinere Klassen. Die Vorgaben des Volksschulamtes des Kantons Zürich sind jedoch wenig flexibel. Die Stellenprozente oder auch Vollzeiteinheiten teilt der Kanton den Schulgemeinden nach der Gesamtschülerzahl zu und nicht nach Anzahl Schulklassen. Das durchschnittliche Betreuungsverhältnis liegt bei 16 Kindern. Bei einer Klasse mit 19 Kindern ergäbe dies ein Pensum von 125 Stellenprozenten. Weiter gibt das Volksschulamt des Kantons Zürich den Schulgemeinden vor, wie viele Schülerinnen und Schüler maximal pro Klasse unterrichtet werden dürfen. Bei der Klasse A sind dies 25, bei einer Klasse B 23 und bei einer Klasse C 18. Gemischte Klassen, also A/B oder B/C müssen kleiner ausfallen. Hat eine Schulleiterin nun beispielsweise 54 Jugendliche, welche die Klasse A besuchen können, gibt es die Option, drei Klassen mit 18 Jugendlichen oder zwei Klassen mit 27 Jugendlichen zu bilden. Bei der Option der grösseren Klasse ist es gezwungenermassen nötig, Halbklassen zu bilden oder Lektionen zusammenzulegen. Manfred Knecht lässt zum Beispiel seine drei kleinen B/C-Klassen gemeinsam turnen. So spart er drei Lektionen, was ungefähr 11 Stellenprozenten entspricht. Eine Jongliererei!
Bildungsniveau mit ausschlaggebend
Neben diesen durch den Kanton definierten Rahmenbedingungen spielen auch die Kapazität von Räumlichkeiten, das Bildungsniveau der Jugendlichen sowie die pädagogische Haltung eine Rolle bei der Wahl des Unterrichtsmodells. Die Sekundarschule Bonstetten legt besonders grossen Wert auf die Integration von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. «Wir sind grundsätzlich ressourcenorientiert unterwegs, planen aber wenn immer möglich mit kleinen C-Klassen mit 10 bis 13 Schülerinnen und Schülern», meint dazu Jeannette Egli, Schulleiterin der Sek Bonstetten. Sie leitet seit diesem Sommer die knapp 400 Schüler starke Schule und lobt die Schulpflege, welche sie in ihrem Vorhaben trage und unterstütze. In der Sek Bonstetten gibt es im aktuellen Schuljahr neun A-Klassen im ersten und zweiten Jahrgang mit je zirka 20 Schülern. Im dritten Jahrgang werden sechs B-Klassen mit 18 bis 20 Jugendlichen geführt. Die A-Abteilungen wurden aufgrund zahlreicher Austritte von Gymnasiasten auf drei Klassen mit je 25 Jugendlichen zusammengelegt. Dies, um Vollzeiteinheiten einzusparen.
In der Sek Hausen präsentierte sich vor einigen Jahren das Problem, dass sie zu viele A-Schüler zählte und man so keine sinnvollen Klassenzüge bilden konnte. Hauptsächlich aus diesem Grund suchte Schulleiterin Astrid Fink nach andersartigen Unterrichtsformen. Auch ausserkantonal. Fündig wurde sie beim Modell der abteilungsdurchmischten Klassen. So werden seit 2008 alle Schüler des jeweiligen Jahrgangs gemischt und in ungefähr 20 Schüler zählende Klassen aufgeteilt. In den Sprachfächern sitzen die Jugendlichen in Niveauklassen, in den übrigen Fächern «tous ensemble». Dadurch entsteht eine überaus heterogene Gruppe, die Astrid Fink als Vorteil erachtet. Dies erging anfangs nicht allen so. Einige Lehrpersonen konnten sich mit dem neuen System nicht arrangieren und verliessen die Schule. Eine gehörige Portion Aufklärungsarbeit war bei der Elternschaft nötig. Die Skepsis war gross. Vorbehalte mussten abgebaut werden. Heutzutage gilt der akademische Weg für viele Eltern als Nonplusultra. Eine Mutter erzählte, dass sie, weil ihr Sohn die Sek B besuchte, Beileidsbekundungen von Bekannten erhalten hatte. Dies in einem Land mit einem der durchlässigsten Bildungssysteme der Welt.
Abhilfe mit dem Modell Mosaik
Das Ungewohnte ist in der Schulgemeinde Hedingen Usus. Mit knapp 90 Sek-Schülern eine kleine Schule. Zu den Herausforderungen meint Rita Sauter, Schulleiterin der Schule Hedingen: «Für uns ist es wegen der schwankenden Schülerzahlen nicht möglich, gleichmässige Jahrgangsklassen zu bilden. Denn die Schülerzahlen ändern sich von Jahr zu Jahr und dies kann mit der Durchmischung aufgefangen werden.» Deshalb hat sich die Schulgemeinde im August 2010 für das Modell Mosaik entschieden. Das heisst, dass hier alle Schüler, ungeachtet des Alters und des Niveaus, in einer Klasse unterrichtet werden.
Zurzeit bestehen vier Klassen. In jeder gibt es Lerngruppen mit je fünf bis sechs Schülern, meist mit Vorsitz eines 3.-Klasse-Schülers. Alle Fächer werden als ganze Klasse belegt. Ausser die Fächer Natur & Technik, Englisch und Französisch, diese werden im Jahrgang unterrichtet. Die Durchmischung wird unterdessen aus pädagogischer Sicht befürwortet. Die Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen werden positiv beeinflusst. Den Betrieb der Schule bezeichnet Rita Sauter als überaus aufwendig. «Einerseits wegen der anspruchsvollen Unterrichtsform, aber auch wegen der bescheidenen Grösse der Schule mit gleichbleibenden Aufgaben, die verteilt werden müssen. Doch es lohnt sich!»
Die verschiedenen Unterrichtsmodelle im Bezirk mögen wie ein buntes Mosaik erscheinen. Das zentrale Anliegen manifestiert sich jedoch bei allen Schulgemeinden ohne Ausnahme: Eine positive, stimulierende Lernumgebung für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen.