«Wir müssen resilient bleiben»
Im lamarotte ging es um Selbstbestimmtheit auf dem Weg in die digitale Zukunft
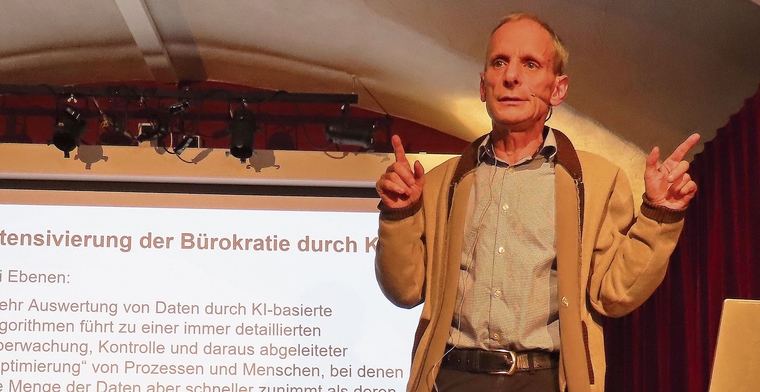
Es vergeht kein Tag mehr, gefühlt schon kaum mehr eine Stunde, ohne dass wir mit dem Begriff «KI» respektive seiner englischsprachigen Entsprechung «AI» (Artificial Intelligence) konfrontiert werden. Grosse Hoffnungen sind mit der sogenannten künstlichen Intelligenz verbunden, bei vielen herrscht aber auch die Angst vor, dass sie uns Menschen in Zukunft quasi überflüssig machen könnte.
Immer mehr Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben, können Algorithmen nun scheinbar plötzlich besser als wir. Selbst Schauspieler und Schauspielerinnen bangen seit der kürzlich durch die Medien gegangenen Meldung über eine am Computer erschaffene, künstliche «Berufskollegin» auf einmal um ihre beruflichen Aussichten.
Doch was sagt einer der angesehensten Ökonomen unseres Landes zu dieser Entwicklung? Der Kulturkeller lamarotte in Affoltern wollte es wissen und hat deshalb Mathias Binswanger zu einem Vortrag über das Thema eingeladen. Der aus St. Gallen stammende Professor für Volkswirtschaftslehre, Privatdozent und Publizist ist unter anderem für seine kritische Auseinandersetzung mit Themen rund um die Ökonomie bekannt.
Binswanger startete seinen Vortrag, der wie sein 2024 erschienenes Buch den Titel «Die Verselbständigung des Kapitalismus» trägt, mit dem in dieser Jahreszeit stets aktuellen Thema der Krankenkassen-Vergleiche. Sind die in dieser Sparte omnipräsenten Vergleichsdienste nun objektiv oder nicht? Diese Frage konnte auch der Professor nicht beantworten, aber eines stellte er dazu klar: «Wenn wir die KI fragen, wissen wir es noch viel weniger.» Bezüglich der Gesundheitsapps auf dem Handy, die nun gewisse Krankenversicherer für ihre Kundschaft bereitstellen und bei der Benutzung eine Prämiensenkung versprechen, meinte Binswanger, dass diese Reduktion in der Regel nicht der Rede wert sei, ausser man habe eine Zusatzversicherung. Sein Ausblick in die Zukunft verhiess zudem nichts Gutes: «Man muss sich nun vorstellen, wie dies weitergehen könnte mit Krankenkassen und KI, Apps überprüfen über Nanopartikel rund um die Uhr meinen Körper.» Bestimmt erschauderte nun der eine oder die andere im gemütlichen Theaterkeller innerlich über diese Vorstellung. Der Ökonom wies auch darauf hin, dass die Definition, wer noch gesund ist, nicht selten nach Belieben des Gesundheitswesens verschoben werde. «Beispielsweise war früher ein bestimmter Cholesterinspiegel noch ok, doch dann wurde der Grenzwert immer weiter abgesenkt, zugunsten eines ökonomischen Nutzens», so seine Beobachtung.
Im nächsten Teil von Mathias Binswangers Referat wurde es fast schon philosophisch. «Wenn Intelligenz nicht knapp wäre, gäbe es keinen Anreiz, sie künstlich herzustellen», stellte er fest. Mit Gold sei es ebenso, die Knappheit mache das Edelmetall erst so wertvoll. Der Blick des Professors wanderte durch den Saal, das Publikum hing förmlich an seinen Lippen: «Wie wäre es nun, wenn wir Gold auf einfache Weise herstellen könnten, und wird es jetzt durch KI mit der Intelligenz auch so?» Die eingangs angesprochene, bange Frage, was dann unsere Talente, unsere Schöpfungskraft, unsere hart erworbenen Kompetenzen noch wert sind, hing im Raum.
Ist der Maschinenhund intelligenter als sein Herrchen?
Nach einem kurzen Exkurs zu den technischen Grundlagen des selbstständigen Lernens von künstlichen Intelligenzen holte der Referent zu einem Gedankenspiel über einen Hundehalter aus, der mit seinem Vierbeiner spazieren geht. Das Haustier folgt seinem Besitzer, vertraut seinem natürlichen menschlichen Verstand. Wenn man nun aber einen Roboterhund konstruieren würde, von dem der Mensch annähme, er sei intelligenter als er selbst, dann käme es zu einer Umkehrung des Rollenverhältnisses, der Besitzer traute dem Maschinenwesen plötzlich mehr als seiner eigenen Intelligenz. «Man setzt etwas als Tool ein, aber früher oder später wird man selbst zum Tool», lautet Binswangers warnendes Fazit. Gefährlich sei auch, dass eine KI eine eigentliche «Black Box» sei, der der Benützer oder die Benützerin also nicht nachvollziehen könne, wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis komme. «Wir als Anwender finden uns plötzlich in einer ähnlichen Rolle wieder wie die Menschen im Mittelalter, man musste Gott glauben – und Punkt.»
Wir alle sind in jüngster Zeit vermehrt mit Angeboten konfrontiert, bei denen Maschinen uns Entscheidungen abnehmen sollen, man denke etwa an «intelligente» Kühlschränke, die selbstständig Nahrungsmittel nachbestellen, oder an in Mobiltelefon-Apps gespeicherte Einkaufslisten, bei denen der Supermarkt schon im Voraus weiss, was wir wohl demnächst einkaufen werden. Dies hat laut Mathias Binswanger Einfluss auf die Konsumentensouveränität, Maschinen würden zu den eigentlichen Konsumenten, sie verglichen Angebote, und am Schluss schlössen sie dann irgendwann auch noch den Kaufvertrag für mich ab. Nur noch ganz grosse «Big Tech»-Firmen seien überhaupt in der Lage, diese Dinge bereitzustellen. Ähnlich wie beim Gesundheitswesen existiere eine Informations-Asymmetrie zwischen dem Kunden und dem Anbieter von Dienstleistungen, der ja Experte auf seinem Gebiet ist.
Ein Verkaufsargument bei Immobilien ist immer öfter die informationelle Vernetzung der Haustechnik, was als Fortschritt gepriesen wird und in vielen Fällen tatsächlich praktisch ist. «Das sogenannte Smarthome ist das Einfallstor für die KI in die eigenen vier Wände», gab der Ökonomieprofessor in dieser Sache zu bedenken. Alles kommuniziere mit allem, und diese Vorgänge seien eine fantastische Möglichkeit, uns zu überwachen. So sei etwa der erwähnte «smarte» Kühlschrank in der Lage, Muster zu erkennen, wie die Benützerin oder der Benützer sich ernähre. Würden diese Muster dann mit anderen Daten zusammengeführt, sei man schon bald total überwacht. «Unheilige Allianzen» zwischen dem Staat und den Big-Tech-Firmen in solcherlei Absicht böten sich geradezu an. Mathias Binswanger sprach im weiteren Verlauf seines Referats auch die neue Controlling-Bürokratie an, welche immer mehr Zeit in Anspruch nehme, und er plädierte dafür, sich nicht zu abhängig zu machen. Alternativen aufrechtzuerhalten, sei notwendig, geschichtlich könne man dazu das weströmische Reich als Beispiel anführen, es habe seine Kriege nicht mehr selber geführt, und die hierfür engagierten Söldner hätten sich irgendwann gegen das eigene Reich gerichtet. Als der Moderator des Abends, Bernhard Schneider, vom Referenten wissen wollte, wofür er selbst KI verwende, antwortete dieser, die üblichen frei verfügbaren Programme ebenfalls zu benützen, aber im Wissen, dass diese auch darauf abzielten, süchtig zu machen. Auf die Frage einer Zuhörerin, welchen Beruf unsere Kinder denn überhaupt noch erlernen sollen, reagierte der Referent mit dem Argument, es gebe auch viele bremsende Faktoren, ausserdem liege es an uns, unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir dies für richtig hielten.



